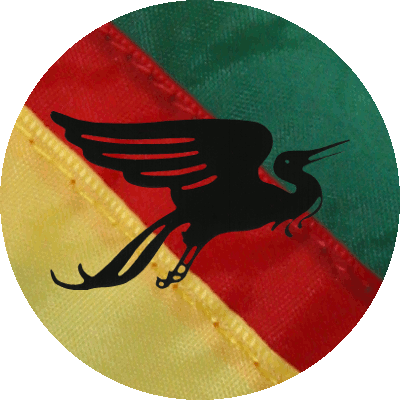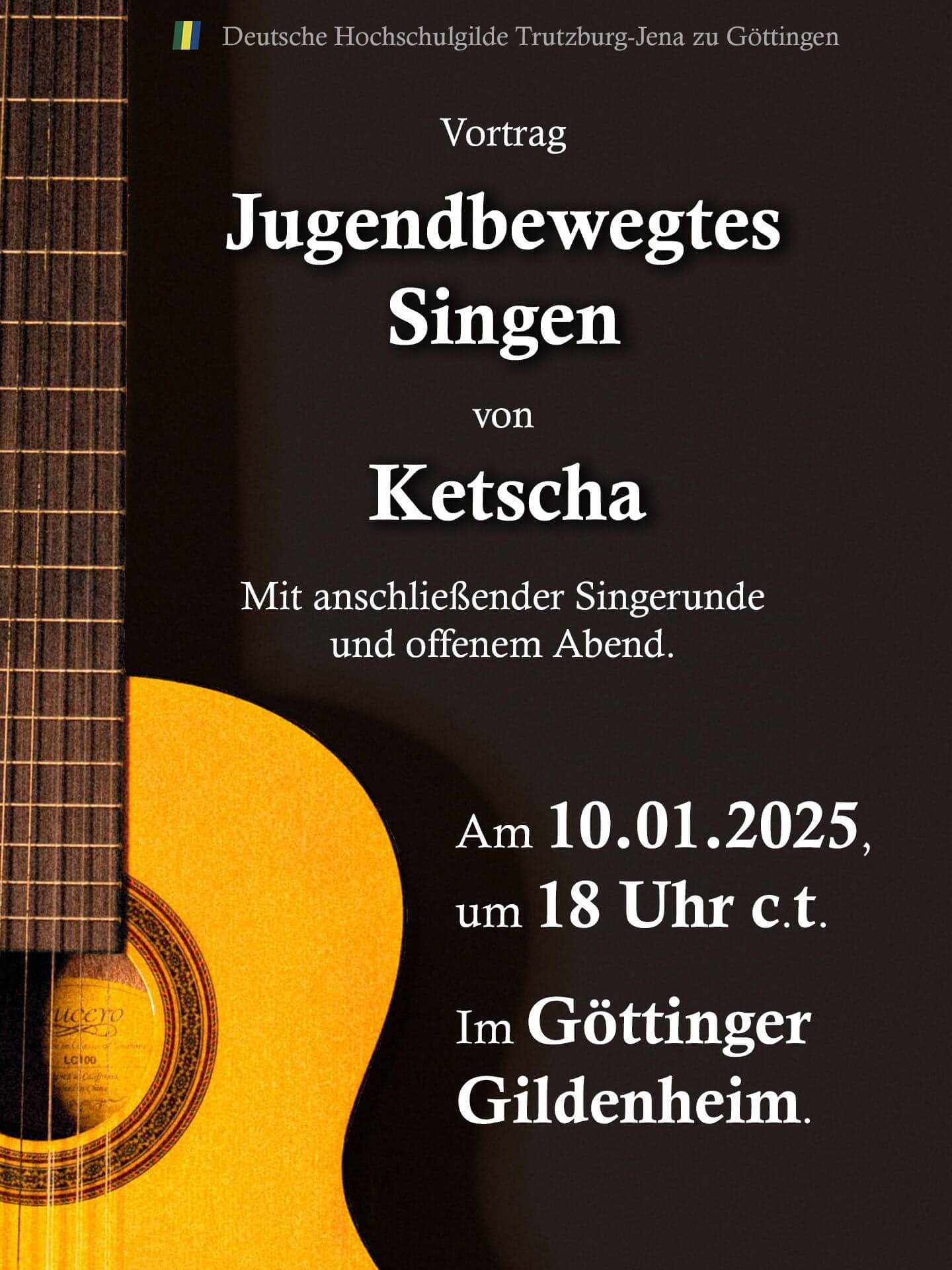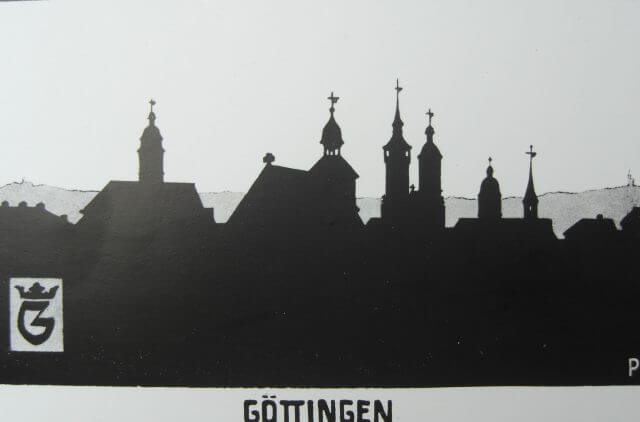Für ihren sogenannten Göttingentag, der regelmäßig am Tag der Deutschen Einheit stattfindet, hatte die Trutzburg Jena zu Göttingen 2024 wieder einmal nach Jena eingeladen, zumal unsere namensgebende Vorgängergilde Trutzburg Jena dort vor 101 Jahren gegründet wurde. Überraschend hoch war mit 27 die Zahl der Teilnehmer, und ohne kurzfristige krankheitsbedingte Absagen wären es noch zwei mehr gewesen. Die allermeisten fanden sich bereits am 2. Oktober in unserer Hauptunterkunft, dem traditionsreichen Gasthof „Schwarzer Bär“ ein, in dem unter anderem bereits Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe und Otto von Bismarck eingekehrt waren.
Als erster Programmpunkt war der Besuch des sogenannten Napoleonsteins auf dem Windknollen, einer Anhöhe auf dem Jena überragenden Landgrafenberg, vorgesehen. Dort legten die Gründungsburschen am 15. Mai 1923 erstmals ihr grün-gold-blaues Band an und riefen die Gilde Trutzburg Jena ins Leben. Das Unterfangen wäre beinahe gescheitert, da es so zu schütten anfing, dass eine Wanderung zum Napoleonstein nicht möglich erschien und Autos und ein Alternativprogramm organisiert werden mussten. Am Ende öffnete der kontaktierte Betreuer des „Museums 1806“ in Jena-Cospeda auf dem Landgrafenberg für unseren ursprünglich nicht vorgesehenen Besuch etwas länger.
Im kleinen „Museum 1806“, das vom Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 2006 e. V. betrieben wird und in dem mit Übersichten zu den Schlachtverläufen und zahlreichen Waffen, Uniformen und anderen historischen Ausrüstungsgegenständen die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14.Oktober 1806 dokumentiert wird, versorgte uns Frank kenntnisreich mit Hintergrundinformationen. Als wir das Museum verließen, hatte es überraschenderweise zu regnen aufgehört, und eine größere Gruppe von uns wagte doch noch den Weg zum Napoleonstein; angesichts des aufgeweichten Bodens und der Pfützen eine rutschige Angelegenheit.
An Ort und Stelle gab unser Historiker Ulrich an diesem Gründungsort einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Trutzburg Jena. Die zunächst etwas verwunderliche Tatsache, dass sich eine bereits damals patriotisch gesinnte Gilde ausgerechnet am Ort einer der schwersten Niederlagen der Preußen und Sachsen gegen die Franzosen unter Napoleon I. gründete, ist wohl damit zu erklären, dass die jungen, teilweise weltkriegserfahrenen Gildenschafter nach dem verlorenen 1. Weltkrieg und dem Diktatfrieden von Versailles ähnlich wie viele Deutsche nach 1806 wieder auf bessere Zeiten hofften. Auf dem Windknollen steht übrigens nicht mehr der ursprüngliche Stein. Der jetzige ist erst 1992 vom Verein Academica & Studentica Jenensia e. V. neu errichtet worden. Den Abend verbrachten wir bei gutem Essen, Getränken und Gesprächen im Hotel.
Am Donnerstagvormittag nahm uns ein Privatdozent am „Hanfried“, dem Denkmal des Gründervaters der Jenenser Universität, in Empfang. Er geleitete uns zum Collegium Jenense, Gründungsstätte und Zentralort der Friedrich-Schiller-Universität Jena und machte uns dort mit der alten Unigeschichte vertraut: Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen gründete 1547/1548 eine neue „Hohe Schule“, nachdem er im Schmalkaldischen Krieg mit der Kurwürde und großen Teilen seines Herrschaftsgebietes auch die Residenz- und Universitätsstadt Wittenberg verloren hatte. 1557 erhielt sie von Kaiser Ferdinand I. das Universitätsprivileg und wurde 1558 offiziell eingeweiht.
Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte die Alma Mater Jenensis ihre erste Blütezeit. Die Grundlagen dafür schuf Johann Wolfgang von Goethe als Weimarer Minister. Herausragende Literaten und Philosophen lehrten und studierten hier: Hegel, Fichte, Schelling, Schiller, die Gebrüder Schlegel, Novalis, Hölderlin und Brentano, um nur die wichtigsten Namen zu nennen. Jena war auch Gründungsort der gesamtdeutschen Burschenschaft am 12. Juni 1815 im Gasthaus „Grüne Tanne“, am Ende der „Befreiungskriege“ gegen Napoleon. Die Versammelten gelobten, für die „Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlands“ einzustehen.
Von 1870 bis 1940 erlebten Jena und seine Universität eine zweite Blütezeit. Sie ist mit den Namen des Physik-Professors Ernst Abbe, des Universitätsmechanikers Carl Zeiß und des Glaschemikers Otto Schott verbunden. Der von ihnen ausgelöste technische Fortschritt sowie das visionäre Unternehmenskonzept der Zeiss-Stiftung – die Belegschaft wurde am Gewinn beteiligt – zog hochqualifizierte Arbeiter aus ganz Deutschland an. Die Einwohnerzahl stieg zwischen 1870 und 1914 um 150 Prozent an. Die außerordentlichen Gewinne flossen größtenteils in den Bau kultureller Einrichtungen der Stadt Jena.
Vom Collegium Jenense mit dem Kollegienhof und einer kleinen universitätsgeschichtlichen Ausstellung wechselten wir zum 1920 fertiggestellten Pädagogischen Institut und zur Zeitgeschichte der Universität. Dr. Gerber referierte zu den „Wendepunkten“ der Unigeschichte im 20. Jahrhundert: dem Übergang von der Monarchie zur Weimarer Republik 1918 bis 1920, von der Republik in den nationalsozialistischen Staat, der in Thüringen mit einer nationalsozialistischen Landesregierung bereits 1932 einsetzte, dem allmählichen Umbau in eine sozialistische Universität nach 1945 und schließlich der Friedlichen Revolution von 1989/90, die 1992 in eine Abwicklung und Wiedergründung mündete. Der Dozent nahm jeweils die Professorenschaft und die Studentenschaft in den Blick. Er verwies unter anderem auf die Beharrungskräfte gegen eine weltanschauliche Vereinnahmung in größeren Teilen der Professorenschaft sowohl nach 1932/33 als auch nach 1945 und illustrierte dies unter anderem an Universitätsjubiläen.
Zu Mittag speisten wir anschließend gemeinsam in der Pizzeria „L’Osteria“ direkt am neuen Wahrzeichen Jenas, dem sogenannten JenTower. Einige, die noch nicht abreisen mussten, schlossen sich danach einer eineinhalbstündigen Stadtführung an, die wiederum am Hanfried begann. Mit dem Denkmal verbindet sich ein Brauch für frisch promovierte Jenenser: Sie sind gehalten, einen Kranz über die Spitze des Schwertes des Hochschulgründers zu werfen; vergleichbar der Göttinger Sitte, dem Gänseliesel auf dem Marktbrunnen den Erfolg mit einem Kuss zu danken. Der Stadtführer setzte nach dem geballten Programm zur Universitätsgeschichte andere Schwerpunkte. Auf sehr unterhaltsame Art und Weise erläuterte er uns die Bedeutung der Kirchen und hervorzuhebenden alten Gebäude, von denen auch in Jena viele im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.
Besonders in Erinnerung blieb die Geschichte des 1972 eingeweihten, bereits erwähnten JenTowers. Zwischen 1991 und 2004 renoviert, neu verkleidet und um zwei Geschosse und eine Turmspitze aufgestockt, ist er derzeit mit 159,60 m Höhe das höchste Bürogebäude Ostdeutschlands. Ursprünglich sollte das Gebäude als Forschungszentrum des Carl-Zeiss-Kombinates dienen, bis sich herausstellte, dass die höhenbedingten Schwankungen des Gebäudes sensible Forschungen nicht zuließen. Für den Turm wurden halbe Straßenzüge weggerissen, der dadurch entstandene große freie Platz wird derzeit überwiegend als Parkplatz genutzt. Hier soll nach einer entsprechenden Bevölkerungsumfrage in Zukunft mehr Wohnraum in weiteren modernen Gebäuden entstehen, sofern ausreichend finanzstarke Investoren gefunden werden.
Wer nicht noch ein, zwei Tage länger in Jena blieb, reiste nach der Stadtführung ab. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen lassen sich so zusammenfassen, dass es trotz etwas widrigen Wetters zwei sehr informative Jubiläumstage waren, in denen auch der persönliche freundschaftliche Kontakt nicht zu kurz kam – und dass wir Trutzburger in gewissen Zeitabständen gerne wieder an den Ursprungsort unserer Gilde zurückkehren möchten.